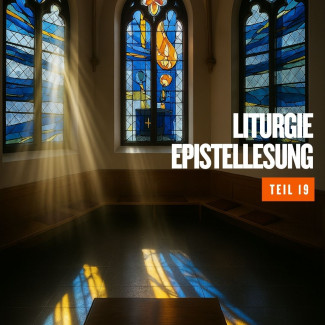Nach der alttestamentlichen kann ein Gemeindelied folgen. Zu den Liedern und ihrer Bedeutung wird es noch einmal einen eigenen Abschnitt geben. Eingeleitet wird die Epistel mit den Worten:
Die Epistel für den Sonntag NN steht geschrieben: …
Und dann folgt die Nennung der Textstelle und die Verlesung der Epistel, die mit den Worten schließt:
Worte der Heiligen Schrift.
Worauf die Gemeinde mit den Worten antwortet:
Gott sei Lob und Dank.
So weit, so gut. Aber warum wird im Gottesdienst eine Epistel, also eine Briefstelle vorgelesen? Welche liturgische Bedeutung und vor allem auch welche Geschichte hat das?
Ihren Ursprung hat die Epistellesung in den frühen christlichen Gemeinden, die mit dem Vorlesen der Briefe der Apostel und insbesondere der Paulusbriefe begannen. Man könnte sagen, dass die Briefe gewissermaßen als die ersten Evangelien gelten können, denn die vier Evangelien nach Markus, Lukas, Matthäus und Johannes wurden erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts aufgeschrieben. Damit sind die Briefe die älteren Glaubenszeugnisse. Und damit erklärt sich auch die Reihenfolge der Lesungen im Gottesdienst – Alttestamentliche Lesung – Epistel – Evangelium.
Diese Reihenfolge hat ihren Ursprung aber nicht nur im – sagen wir mal – Erscheinungstermin, sondern auch in der Dramaturgie des Gottesdienstes, weil das unmittelbare Wort Jesu als Höhepunkt am Schluss der Lesungen die Gemeinde erreichen soll.
Und genau in diesem Dreiklang von Lesungen hat die Epistellesung eine zentrale Bedeutung im Rahmen der Verkündigung, denn sie bereitet die Gemeinde auf das Evangelium und damit auch die Verkündigung vor.
An manchen Orten unserer Kirchengemeinde muss ich manchmal schmunzeln, an welcher Stelle die Gemeinde aufsteht und an welcher nicht. Steht die Gemeinde z.B. bei der Epistel auf, steht sie an der falschen Stelle auf. Warum? – Das Sitzen symbolisiert eine Haltung des aufmerksamen Zuhörens.
Traditionell folgt auf die Epistellesung das Halleluja-Lied. Es sei denn, wir befinden uns in der Passions- oder Adventszeit.
Das "Halleluja" nach der Epistellesung hat im evangelischen Gottesdienst eine bedeutende liturgische Funktion als Antwortgesang der Gemeinde. Es ist hebräisch und bedeutet „Lobet den HERRN!“ Es ist Ausdruck der Freude und des Lobes Gottes. Liturgisch bereitet es die Gemeinde auf die folgende Evangeliumslesung vor, in der Christus im Wort gegenwärtig wird.
Das Halleluja gilt als Begrüßung Christi, der im Evangelium zu der Gemeinde spricht. Mit dem Halleluja begrüßt die Gemeinde Christus als König und feiert seine Gegenwart im Wort. Mit dem Halleluja bringt die Gemeinde die Freude über die Gegenwart Christi im Gottesdienst zum Ausdruck.
Pfr. Martin Dubberke