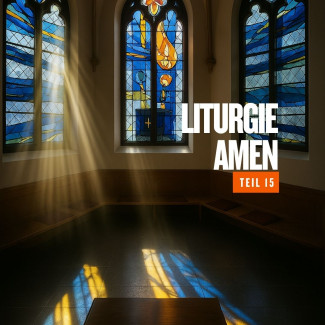Erst wenn „Amen“ gesagt worden ist, ist es auch der erste Teil des Gottesdienstes, die Eröffnung und Anruf abgeschlossen und es geht zum nächsten Teil des Gottesdienstes über.
Warum hebe ich an dieser Stelle so sehr das „Amen“ hervor? – Weil das Amen immer zu kurz kommt. Wir sprechen es in jedem Gottesdienst mehrfach. Aber ist uns eigentlich immer bewusst, was es bedeutet?
Vier Buchstaben – ein kleines Wort mit einem großen Gewicht. Dieses Wort ist älter als jede Kathedrale und auch älter als die Kirche selbst. Ein kleiner Laut, zwei Silben – und doch ein Fundament des gemeinsamen Glaubens.
Dieses „Amen“ ist kein höfliches „So sei es halt“, kein liturgisches Satzzeichen. Es ist eine Bekräftigung, ein Echo des Vertrauens: Es steht fest. Es soll geschehen. So kam das Wort schon im alten Israel über die Lippen der Gemeinde, wenn Segen, Lobpreis oder Gebet verklangen. Im Ersten Buch der Chronik, im 41. Psalm, antwortet das Volk mit „Amen“, als wolle es sagen: „Dieses Wort gilt uns – wir nehmen es an.“
So trägt das „Amen“ den Atem der Gemeinschaft. Es ist das demokratischste Wort des Gottesdienstes, geboren aus Mitsprache und Zustimmung, lange bevor es für diese Begriffe überhaupt Vokabeln gab.
An diesem alten Ruf hielt schließlich auch die Urgemeinde fest: Paulus erwähnte das „Amen“ der Versammelten wie eine Selbstverständlichkeit. Martin Luther sah im Amen den Ausdruck eines gewisshaften Glaubens, eines Vertrauens, das sich etwas traut: „Ja, Vater, so gewiss wird es geschehen.“ Das Amen der Gemeinde nach dem Kollektengebet ist kein bloßer liturgischer Reflex, sondern ein Echo aus tiefstem Herzen, das in Theologie und gottesdienstlicher Praxis einen festen Ort hat. Oder, wie Luther schreibt:
„Amen, Amen, das heißt: Ja, ja, so soll es geschehen.“
So steht es auch im Kleinen Katechismus.
Hier, an dieser Stelle des Gottesdienstes, am Übergang von Eröffnung und Anrufung zu Verkündigung und Bekenntnis, findet das Amen seine natürliche Heimat. Das Kollektengebet fasst die Anliegen der Gemeinde zusammen – Dank, Bitte, Lob. Wenn der Liturg spricht, tut er es im Namen aller. Erst durch das Amen machen alle sein Gebet zu ihrem Gebet. Es ist das Siegel der Gemeinschaft, das „Ja“ der Glaubenden zur Sprache ihres eigenen Herzens. Das Amen gehört liturgisch gesehen der Gemeinde.
Agende und Kirchenordnungen kennen dafür genaue Choreografien: Auf Gesungenes folgt ein gesungenes Amen, auf Gesprochenes ein gesprochenes. Doch in der Praxis geschieht mehr – ein Moment leuchtender Einheit. Für einen Augenblick verschmilzt der Einzelne mit der Gemeinschaft, die Gemeinde mit dem Gebet, das Wort mit dem Glauben.
Im besten Sinn ist das Amen nach dem Kollektengebet der ersten großen gemeinsamen Atemzug des Gottesdienstes. Es bereitete die Gemeinde darauf vor, als ein Leib in das Hören, das Bekennen und auch das Schweigen einzutreten.
Und so klingt es, am Ende dieses kleinen Gebets, wie der Herzschlag des Gottesdienstes selbst – schlicht, vertraut, unverrückbar: Amen.
Pfr. Martin Dubberke