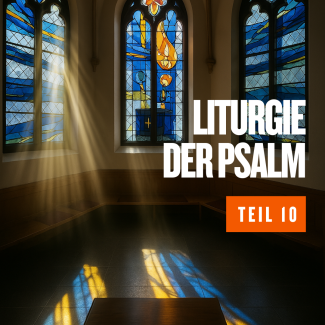Warum singen oder sprechen wir eigentlich nach dem Eingangslied einen Psalm? Nach dem Eingangslied folgt in unserem Gottesdienst der Psalm, der ja im Grunde genommen auch ein Lied ist. Der Psalm ist damit ein Element, das manchem zunächst wie eine Dopplung vorkommen mag. Warum aber gibt es diesen biblischen Text direkt zu Beginn?
Die Antwort führt uns weit zurück in die Geschichte des christlichen Gottesdienstes. Schon im 7. Jahrhundert entwickelte sich in Rom der sogenannte Introitus - ein Eingangspsalm, der
auf Papst Gregor den Großen zurückgeht. Ursprünglich war das ein ganz praktisches Element: Während die Priester und Ministranten von der Sakristei durch die Kirche zum Altar zogen, sang der Chor einen Psalm. Dieser Prozessionspsalm begleitete also den liturgischen Einzug.
Was damals eine praktische Funktion hatte, erhielt schnell eine tiefere spirituelle Bedeutung. Der Psalm wurde zum Tor des Gottesdienstes - er bereitete die Gemeinde innerlich auf die Feier vor und stimmte auf das jeweilige Kirchenjahr ein. Nicht umsonst tragen viele Sonntage ihre Namen nach den ersten Worten ihres Introituspsalms: Estomihi ("Sei mir"), Okuli ("Meine Augen") oder Judika ("Richte").
Martin Luther schätzte dieses Element so sehr, dass er es in der Reformation beibehielt. Er wollte sogar wieder ganze Psalmen singen lassen, nicht nur Ausschnitte. Für ihn war klar: Die Psalmen sind das älteste Liederbuch von Christen und Juden gemeinsam.
Aber warum gerade die Psalmen? Diese 150 biblischen Lieder haben eine einzigartige Eigenschaft: Sie spiegeln die gesamte Bandbreite menschlicher Erfahrungen wider - von tiefster Verzweiflung bis zu überschäumender Freude. Wenn wir einen Psalm sprechen oder singen, treten wir ein in diesen uralten Gebetsschatz und verbinden unsere Lebenserfahrung mit der Glaubensgeschichte Israels und der Kirche.
Der traditionelle Abschluss mit dem "Ehre sei dem Vater" - dem sogenannten Gloria patri - macht dabei deutlich: Diese vorchristlichen Texte beten wir als Christen im Geiste Jesu. Das Gloria patri entstand übrigens schon im 4. Jahrhundert als Antwort auf theologische Streitigkeiten und sollte klarstellen: Die Psalmen werden im Glauben an den dreieinigen Gott gebetet.
So ist der Psalm nach dem Eingangslied alles andere als überflüssig. Er ist vielmehr das geistliche Tor zu unserer Gottesdienstfeier - ein Moment der Sammlung und Vorbereitung, der uns vom Alltag in die besondere Zeit mit Gott hinüberführt. Mit den Worten der Psalmen treten wir ein in den großen Chor derer, die seit Jahrtausenden zu Gott beten, klagen, danken und ihn preisen.
Pfr. Martin Dubberke