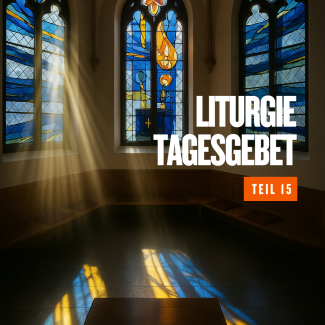Die klassische Kollekte gliedert sich in drei Abschnitte: Anrede an Gott – Bitte um eine bestimmte Gabe – Conclusio.
Die klassische Anrede richtet sich an Gott den Vater oder auch direkt an Jesus Christus. Die Anrede wie z.B. „Allmächtiger Vater“ wird durch einen Bezug auf sein Heilswirken ergänzt:
„Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch Jesus Christus neues Leben geschenkt.“
Nun folgt eine Bitte in der Wir-Form, die sich ebenfalls auf sein Heilswirken bezieht:
„Wir bitten dich: Stärke unseren Glauben, damit wir deine Liebe erkennen und in der Gemeinschaft deiner Kirche wachsen.“
Dem folgt nun der Ziel- und Folgesatz:
"Schenke uns deinen Heiligen Geist, dass wir deine Gnade nicht nur für uns erfahren, sondern sie auch in Wort und Tat weitergeben.“
Nun wird das Kollekten- oder auch Tagesgebet mit einer Conclusio mit Berufung auf Jesus Christus und einen einem trinitarischen Lobpreis abgeschlossen:
„Hilf uns, in unserer Welt Zeugnis von deinem Heil zu geben und ein Zeichen deiner Barmherzigkeit zu sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Dir sei Ehre und Preis, Gott Vater, Schöpfer aller Welt. Dir sei Lobpreis, Jesus Christus, Erlöser der Menschen. Und dir sei Dank und Herrlichkeit, Heiliger Geist, Tröster und Geber des Lebens, jetzt und allezeit und in Ewigkeit.“
Doch wo hat dieses Gebet seine Wurzeln? Der Ursprung des Kollektengebets liegt im jüdischen Tagzeitengebet. Als die Christen es adaptierten, ging es schnell in die liturgische Praxis von Mönchsgemeinschaften über. Und so entstanden für jeden Tag oder jedes Fest entsprechende Kollektengebete. Die Reformation übernahm diese Kollekten und übersetzte sie ins Deutsche und fügte mit der Zeit neue Kollekten hinzu. Im Vorwort zur Deutschen Messe betonte Martin Luther den pädagogischen Wert dieser Gebete.
Und warum schließt es den ersten Teil des Gottesdienstes ab? Was ist der Sinn und Zweck dieses Gebets an dieser Stelle? Schon seit Mitte des 5. Jahrhunderts steht das Kollektengebet vor dem Lesungsteil, vor „Verkündigung und Bekenntnis“, denn es soll die Gemeinde am Ende des Eingangsteils sammeln und auf das Thema des Sonntags vorbereiten. Sammeln meint hier, zu sich zu kommen, ganz anzukommen und seine Gedanken und Offenheit auf das Wort Gottes zu konzentrieren, zu fokussieren. Das Kollektengebet hat also nichts mit der Kollekte zu tun, die im Gottesdienst gesammelt wird. Beidem liegt aber das gleiche lateinische Wort zugrunde: collectio = Sammlung.
Pfr. Martin Dubberke