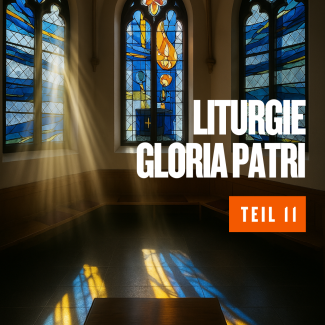Nach dem Psalm folgt das Gloria Patri, das „Ehr sei dem Vater“, wie es im Evangelischen Gesangbuch unter Nummer 177 in drei Versionen zu finden ist.
In unserer Gemeinde hier in Garmisch-Partenkirchen ist es nicht üblich, auf den Psalm das klassische Gloria Patri folgen zu lassen. In der Ordnung für den Evangelisch-Lutherischen Gottesdienst, in unserer Gemeinde sind die Psalmen zum Singen und Sprechen im Evangelischen Gesangbuch ab der Nummer 732 üblich. Wird hier der Psalm im Wechsel gesungen, endet er immer mit einem Gloria Patri, das im Wechsel zwischen dem Liturgen oder Kantor und Gemeinde psalmodiert wird. Das ist aber kein Garmisch-Partenkirchner Sonderweg in der Liturgie, sondern ein bayerisches Spezifikum. Die Gemeinde wird bei uns in der Regel im halbversigen Wechsel mit dem Liturgen im sogenannten Versikelton am Introitus – sprich der Abfolge von Psalm und Gloria Patri - beteiligt.
Ein Nachteil dieser Entscheidung ist allerdings, dass die Perikopenreform nicht synchron mit der Gesangbuchreform gelaufen ist. Während das aktuelle Gesangbuch zwischen 1993 und 1996 eingeführt wurde, trat am 1. Advent 2018 eine umfangreichere Perikopenreform in Kraft. Beide klaffen ein viertel Jahrhundert auseinander. Das bedeutet, dass wir gar nicht alle Psalmen, die wir im Gottesdienst gemeinsam sprechen oder singen sollten, im Gesangbuch stehen, denn die Perikopen, also die Ordnung der gottesdienstlichen Texte hat sich 2018 noch einmal verändert.
Aber warum sollte nach unserer Gottesdienstordnung nach dem Psalm nun das Gloria Patri kommen? Wozu ist es gut, gemeinsam zu singen:
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heilgen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Richtig, es ist ein trinitarisches Lob. Das Gloria Patri ist eine sogenannte kleine Doxologie, also eine kurze Form des Lobpreises der Dreifaltigkeit. Während sich die trinitarische Formel schon schloss in frühester Christenheit dem Psalm anschloss, um diese wie schon gesagt als im Geiste Christi gebetete Psalmen zu kennzeichnen, kam der Faktor Zeit und Ewigkeit erst um 500 hinzu, um das Bekenntnis zu Trinität zu verstärken.
So wie ursprünglich der Psalm von einem Chor gesungen wurde, wurde auch bis zum 19. Jahrhundert das Gloria Patri vom Chor gesungen. Erst im 19. Jahrhundert wurde der Gemeinde hierfür eine eigene Melodie gegeben.
Wichtig: Es gibt hier eine Besonderheit! Zwischen dem Sonntag Judika und dem Karsamstag entfällt das Gloria Patri, weil es in der Passionszeit kein fröhliches Lob gibt.
Aber warum heißt eigentlich die Abfolge von Psalm und Gloria Patri „Introitus“? Die Antwort darauf verrät schon der Name des ersten Liedes, das „Eingangslied“. Und Introitus heißt nichts anderes als Eingang oder Einzug. Seit dem 7. Jahrhundert – also lange Zeit vor der Reformation - war es üblich, dass während des Einzugs des Priesters mit seinem Ministranten, auf dem Weg von der Sakristei bis zu ihren Plätzen im Altarraum der Chor, die sogenannte Schola Cantorum, den Psalm sang und wenn alle an ihrem Platz angekommen waren auf ein Zeichen hin, dieser Gesang mit dem „Gloria Patri“ abgeschlossen wurde. Damit war die Funktion des Psalms die eines Prozessionspsalms, der als Gang-Begleitung gesungen wurde. Wie schon gesagt, hielt die Reformation den Introitus bei und machte daraus wieder einen Chorgesang – zumindest bis ins 19. Jahrhundert hinein.
So wie wir auch bei vielen Elementen unserer Kirchenausstattung sehen können, sind wir ebenso liturgisch nach wie vor tief verwurzelt und verbunden mit der römisch-katholischen Kirche.
Pfr. Martin Dubberke