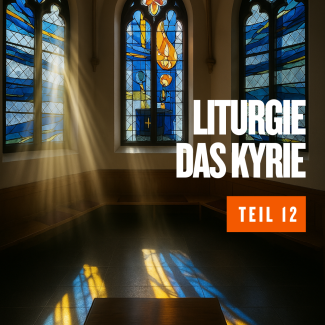Das Kyrie ist mir fast das Schönste im Gottesdienst. Wenn die Orgel den Ton anstimmt und ich die Stimme zum „Kyrie eleison“ erhebe und die Gemeinde mit „Herr, erbarme dich“ antwortet, fühle ich mich mit allen Gläubigen verbunden, die vor uns waren und auch nach uns kommen werden. Ich fühle mich eingebettet in eine lange, sehr lange Geschichte unseres Glaubens und unserer Kirche.
Aber, was ist das Kyrie? Warum singen wir hier Griechisch und die Gemeinde antwortet auf Deutsch? Als wir uns in dieser Woche im Konfi mit dem Thema „Gottesdienst feiern“ beschäftigt haben, habe wir festgestellt, dass in jedem Gottesdienst vier verschiedene Sprachen gesprochen und gesungen werden:
- Deutsch
- Hebräisch – ich sage nur „Halleluja“ oder „Amen“
- Lateinisch – Introitus, Confiteor, Credo, Epistel
- Griechisch – Kyrie und Evangelium.
Vier Sprachen, die auch für die Geschichte unseres Glaubens, die Wege, die unser Glaube genommen hat, um zu uns nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen.
Aber was bedeutet dieser Ruf „Kyrie eleison“, der seinen Ursprung schon in vorchristlicher Zeit hat. Im antiken Heidentum war es ein allgemeiner Bittruf an die Gottheit. Die Christen haben schon früh in ihren Gemeinden diese Formel übernommen. Sie war ihnen vertraut aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wie z.B. Psalm 25,16: …sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend. Und auf Jesus bezogen findet sich der Ruf z.B. bei Matthäus 15,22: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Noch im 4. Jahrhundert wurde im Jerusalemer Gottesdienst das Kyrie während der abschließenden Fürbitten von einer Kinderschar hineingerufen. Im Laufe des 5. Jahrhunderts wanderte das Kyrie auf Richtung Westen. Papst Gelasius I. stellte es an den Anfang der Messe. Damals kam dann auch der Ruf „Christe eleison“ hinzu. In einem weiteren Schritt wurde es ein dreifaches Kyrie, das sich dann auf die Trinität bezog. Während wir um das Erbarmen rufen, bekennen wir uns also auch zugleich zur Dreieinigkeit Gottes, also zu Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Während der Aufklärung verschwand das Kyrie aus dem Gottesdienst und kehrte erst wieder mit der Preußischen Agende von 1822 in den Gottesdienst zurück. Wurde früher das Kyrie von einem Chor gesungen oder als Wechselgesang von Chor und Gemeinde, erhielt es nun die heutige Form als Wechselgesang zwischen Liturgen und Gemeinde.
Durch seine Nähe zum Confiteor, dem Sündenbekenntnis, bekam das Kyrie mehr und mehr die Bedeutung einer Fortführung der Bitte „Gott, sei mir Sünder gnädig“.
Pfr. Martin Dubberke