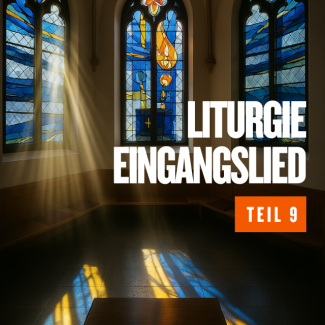In unserer Gemeinde singen wir nach der Begrüßung das Eingangslied. Liturgisch korrekt wird das Eingangslied allerdings erst nach dem Vorbereitungsgebet gesungen. Aber warum singen wir eigentlich im Gottesdienst? Martin Luther, der selbst um die vierzig Liedtexte gedichtet und rund zwanzig Melodien komponiert hat, sagte mal, dass Singen die Antwort auf das Evangelium sei, weil wer glaubt, es nicht lassen kann zu singen, damit andere hören und dazukommen. Salopp gesagt, könnte man auch es auch so sagen: „Wo man singt, das lass Dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder.“ Das Lied soll also dazu einladen, dazuzukommen. Wir alle kennen das doch, wenn irgendwo Musik erklingt, bleiben die Menschen stehen, sei es bei Straßenmusikern, einem Platzkonzert, oder, oder… Das gemeinsam gesungene Lied hat also auch eine einladende und damit innehaltende Funktion.
Dabei hat das Eingangslied im liturgischen Rahmen von Eröffnung und Anrufung eine zentrale Funktion: Es ist gemeinschaftsstiftend. Als ich kürzlich in der Johanneskirche einen Sonntagsgottesdienst ohne Orgel hatte, konnte man das besonders gut wahrnehmen. Ohne Orgel, quasi aus sich selbst heraus zu singen, öffnet etwas Besonderes – denn ohne Orgel spüren wir beim Singen viel mehr uns selbst, unseren Atem, unsere Stimmen, und auch den Menschen neben uns. Es entsteht ein direkter Klang – unverstellt, ehrlich, berührend. Der Berliner Chansonier Klaus Hoffmann bringt das in einem seiner Chansons wunderbar auf den Punkt:
„Wenn du singst, singen alle, die dich sehen.
Und die Welt wird dich verstehen, wenn du singst...“
Musik wird zur Begegnung, jeder Ton wird zur Berührung. Dieses Eingangslied hat eine gemeinschaftsstiftende Funktion. Dieses erste gemeinsame Singen verbindet alle Menschen miteinander. Sie spüren sich mit ihren unterschiedlichen Stimmen und Tonlagen als ein Körper mit verschiedenen Gliedern, der gemeinsam atmet. Besser kann man gar nicht spüren, dass man hier nicht nur für sich sitzt, sondern man sich im Namen Jesu Christi versammelt hat. Das machen auch die bekanntesten Eingangslieder deutlich wie z.B. „Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen“ oder „Fröhlich wir nun all fangen an“ oder „Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören“. Nicht zu vergessen „Gott ist gegenwärtig“ der Eröffnungsschlager schlechthin „Du hast uns, Herr, gerufen“.
Das gemeinsame Singen gleich zu Beginn hat – wie kann es anders sein - auch eine theologische Bedeutung. Damit soll deutlich werden, dass der Gottesdienst keine One-Man- oder One-Woman-Show ist. Gottesdienst ist keine solistische Veranstaltung, sondern ein Gemeinschaftserlebnis. Das Eingangslied macht damit jedem in diesem Gottesdienst deutlich, dass auch er und sie diesen Gottesdienst durch sein Anwesenheit, durch seine Stimme mitgestaltet. Das gemeinsame Singen ist damit Ausdruck dafür, dass sich die Gemeinde versammelt hat und aktiv Gottesdienst feiert.
Dieses gemeinsame Singen war auch Teil der Reformation. Ja, auch zuvor gab es im Gottesdienst Musik und Gesang. So war in der mittelalterlichen Messe der gregorianische Gesang ein fester Bestandteil, doch dieser wurde ausschließlich von den Priestern und in der Regel ausgebildeten Chören gesungen. Der Gemeindegesang kam kaum vor. Die Gemeinde war also passiv.
Als Martin Luther 1526 mit seiner Deutschen Messe den von einem Chor gesungenen Introitus durch das von der Gemeinde gesungene Eingangslied ersetzte, kam das einer Revolution gleicht, denn genau an dieser Stelle dokumentiert sich im Gottesdienst die evangelische Idee vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Die Gemeinde tritt aus der Passivität heraus in die Aktivitität und wird so vom versammelten Objekt zum handelnden Subjekt.
Wer hätte gedacht, das hinter dem einfachen Wort „Eingangslied“ auf dem Gottesdienstzettel so viel steckt?
Pfr. Martin Dubberke